
Die starken Unwetter in diesem Jahr heizten die Diskussionen über die Politik in Bezug auf die Naturgefahren in der Schweiz wieder an. Nach den verheerenden Gewittern im Wallis Ende Juni musste in Saas-Grund ein Todesopfer beklagt werden und aufgrund des historischen Hochwassers der Rhone wurde in Binn eine Person vermisst. Zur selben Zeit verloren bei einem Erdrutsch in Valmaggia (TI) sieben Personen ihr Leben und eine wurde vermisst. Gemäss den Wissenschaftlern werden die Intensität und die Häufigkeit solcher Naturkatastrophen in den kommenden Jahren leider noch zunehmen. Das Wallis ist als Bergkanton solchen Katastrophen in besonderem Mass ausgesetzt.
«Aufgrund seiner Topografie ist das Wallis praktisch allen Arten von Naturgefahren wie Steinschlägen, Felsstürzen, Lawinen, Hangrutschen und Murgängen ausgesetzt», betont Raphaël Mayoraz, Chef der Walliser Dienststelle für Naturgefahren. «Deshalb investiert das Wallis durchschnittlich auch das Achtfache von anderen Kantonen, um sich gegen diese Gefahren abzusichern.»
Diese Investitionen werden von den Gemeinwesen für die Planung und den Bau von Schutzbauten – Dämme, Schutzmauern, Schlammsammler, Schutz- und Lawinengalerien – getätigt und belaufen sich im Wallis auf rund 470 Franken pro Jahr und Einwohner. In den übrigen Kantonen werden dafür durchschnittlich 60 Franken aufgewendet.
Anpassung des politischen Ansatzes
Bisher verfolgte der Kanton grundsätzlich den Ansatz massiver Bauten, um die Bewohner zu schützen. Raphaël Mayoraz spricht sich für eine ergänzende Vision aus. «Die Bemühungen in Bezug auf die Schutzbauten müssen natürlich aufrechterhalten werden. Allerdings muss man sich der Tatsache bewusst sein, dass die Intensität und wahrscheinlich auch die Häufigkeit der Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels zunehmen werden. Die Situation entwickelt sich zu rasch, um sie noch mit Schutzbauten in Schach zu halten. Nur schon die Planung solcher Bauten erfordert in der Schweiz extrem viel Zeit.»

Der Chef der Walliser Dienststelle für Naturgefahren ist der Ansicht, dass die Instandhaltung und Weiterentwicklung der bestehenden Infrastrukturen zwingend an einen flexibleren Ansatz gekoppelt werden müssen. Ziel: sich an diese Gefahren anpassen, indem eine Politik eingeführt wird, die auf Prävention, Überwachung, Prognosen und Organisation beruht. «In diesen vier Bereichen müssen wir noch Fortschritte erzielen. Angesichts der heute verfügbaren Technologien und Kommunikationsmittel kann der Schutz der Bevölkerung und der Infrastrukturen noch verbessert werden.»

Der Klimawandel als erschwerender Faktor
Robert Bolognesi, Schneeforscher und Gründer des Planungsbüros Meteorisk, das auf meteorologische Risiken spezialisiert ist, teilt diese Vision. Es ist offensichtlich notwendig, dass man lernt, mit den Naturgefahren zu leben, insbesondere wenn man sich die Auswirkungen des Klimawandels vor Augen führt. Mit der globalen Erwärmung wird es häufiger zu starken Regenfällen kommen. Die Böden werden mit Wasser gesättigt und destabilisiert. Bei Wärmeeinbrüchen kann sich das Phänomen durch die schmelzenden Schneedecken noch verstärken. Im Winter könnten in mittleren Höhenlagen häufiger Nassschneelawinen vorkommen. In den anderen Jahreszeiten dürften vor allem Erdrutsche und Murgänge zunehmen.
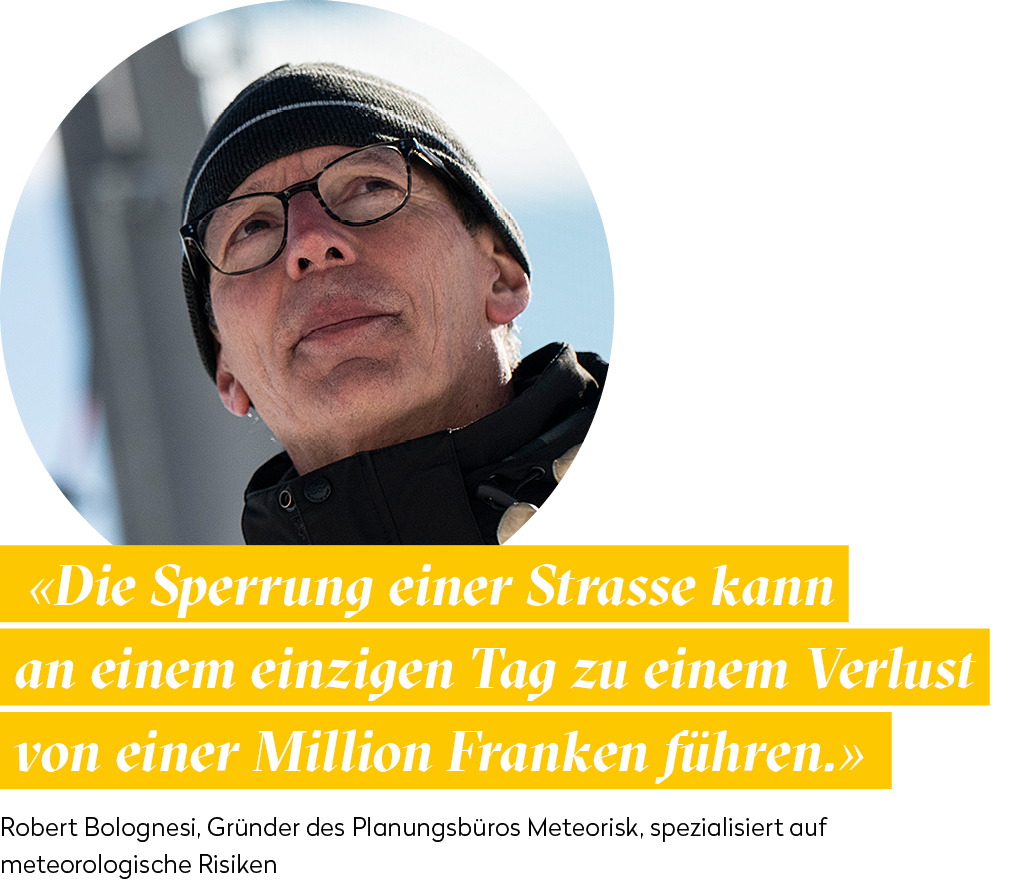
«Die organisatorischen Massnahmen müssen gemeinsam mit der Redimensionierung der bestehenden Schutzinfrastrukturen umgesetzt werden, die zum Teil bereits vor über 50 Jahren gebaut wurden», präzisiert Robert Bolognesi. «Zusätzlich zum globalen Ansatz muss für jede Situation die beste Lösung gefunden werden. Vor Ort kann eine Kombination mehrerer Systeme wie Dämme, Lawinenschutz und Alarmsysteme notwendig sein.» Die Alarmsysteme, die in den letzten Jahren stark verbessert wurden, können zum Beispiel automatisch Verkehrsampeln regeln, um den Verkehr zu stoppen, falls Erdbewegungen festgestellt werden. Nach Möglichkeit sollen auch Strassensperrungen verhindert werden, sofern es die Sicherheitsbedingungen zulassen.
«Eine Strassensperrung kann ungeahnte Folgen haben», ergänzt der Schneeforscher. «Ohne Strassenzugang können gewisse Situationen schnell dramatisch werden. Denken wir nur an eine schwerverletzte Person, eine hochschwangere Frau oder eine Person, die dringend auf Medikamente angewiesen ist. Ausserdem sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht zu unterschätzen. Allein im alpinen Tourismus- und Freizeitbereich wird geschätzt, dass die Sperrung einer Strasse zu einem grossen Tourismusort an einem einzigen Tag für die betroffenen Wirtschaftsakteure zu einem Verlust von rund einer Million Franken führt.»

Der Wald als natürlicher Verbündeter
Der Wald ist für den Schutz vor Naturgefahren von grosser Bedeutung. In Bezug auf den Boden spielt der Wald nämlich eine wichtige Rolle zur Verhinderung oberflächlicher Erdrutsche mit einer Tiefe von rund zwei Metern.
«Mit den Baumwurzeln schützt der Wald den Boden auf zwei Arten», erklärt der Forstingenieur Mathias Carron, Vorstandsmitglied der SIA-Wallis und geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens Silvaplus, spezialisiert auf Waldstudien, Umwelt und Naturgefahren. «Bereits dank der Evapotranspiration der Pflanzen sind die Böden weniger mit Wasser gesättigt. Dann hält das Wurzelnetz der Bäume auch noch den Untergrund zusammen. Gemeinsam tragen diese beiden Elemente dazu bei, das Risiko von oberflächlichen Erdrutschen zu reduzieren.»
In dieser Hinsicht stellt der Schutz des Walds ein Schlüsselelement dar. Diese biologische Massnahme muss in Verbindung mit einem umsichtigen Ansatz der DOSSIER Dossier | 11 Raumplanung einen besseren Schutz gewisser Risikozonen ermöglichen, insbesondere in Zusammenhang mit der Besiedlung der Berggebiete.
«Der Unterhalt des Walds ist zudem immer noch viel günstiger als Schutzbauten wie zum Beispiel Lawinenverbauungen», fügt der Forstingenieur an. «Das ist ein entscheidender Punkt, weil die Klimaerwärmung mit ausgeprägten Hitze- und Trockenperioden dem Wald stark zusetzt. Um den Schutz vor oberflächlichen Erdrutschen zu maximieren, werden Arten mit Pfahlwurzeln oder Herzwurzeln wie die Weisstanne, die Lärche oder die Eiche bevorzugt. Denn ihre Wurzeln gehen in die Tiefe und breiten sich nicht parallel zum Boden aus, wie dies zum Beispiel bei der Rottanne der Fall ist. So wird der Untergrund gefestigt.»

Ein notwendiges Bewusstsein
Auch wenn man sich durch zusätzliche Schutzbauten, den Einsatz intelligenter Systeme, einen ausgedehnteren Schutz des Walds sowie verstärkte präventive und organisatorische Massnahmen besser absichern kann, bleibt das Grundproblem dasselbe. Das ist auf jeden Fall die Ansicht des Kantonsingenieurs Vincent Pellissier, der die Dienststelle für Mobilität leitet.
«Es besteht eine grosse Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung des Problems und der Realität vor Ort. Unser Strassennetz ist einerseits veraltet und andererseits im Unterhalt zu teuer. Ausserdem wird es stark durch extreme klimatische Ereignisse beeinträchtigt, die immer häufiger auftreten. Trotzdem bieten wir weiterhin eine Verkehrsmobilität von bedeutendem Ausmass an und regelmässig werden Anträge für einen Ausbau eingereicht. Wir gehen einer Katastrophe entgegen. Es wird nicht mehr möglich sein, unsere veralteten Infrastrukturen, die zum grossen Teil in den Jahren 1960 bis 1970 gebaut wurden, zu überwachen und zu unterhalten und gleichzeitig den Erwartungen der neuen Nutzer zum Beispiel in Bezug auf den Langsamverkehr gerecht zu werden. Abgesehen von den sehr begrenzten finanziellen Mitteln handelt es sich auch um ein Problem der Personalressourcen. Mit den verfügbaren Arbeitskräften können Projekte nicht korrekt umgesetzt und betreut werden. Bei Krisen, wie sie in den letzten Jahren vermehrt auftreten, stehen diese Ressourcen immer mehr unter Druck. Trotz dieser Feststellung ist die Budgetrealität unseres Kantons furchterregend. Die Personalressourcen und die finanziellen Mittel werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich abnehmen.»

Mit einer gewissen Distanz stellt sich deshalb die Frage nach der Zugänglichkeit der Berggebiete. Muss der Zugang jederzeit für alle und über ein immer dichteres Netz garantiert werden? «Es handelt sich hier um eine politische Frage, die zu beantworten mir nicht zusteht», fährt Vincent Pellissier fort. «Im Grunde genommen besteht das Problem im unendlichen Wachstum, das in nächster Zeit frontal mit der Endlichkeit der Ressourcen zusammenprallen wird. Als Beispiel kann das verfügbare Land angeführt werden.
Auch die Anforderungen der Nutzer sind sehr hoch. So wird ganz normal erwartet, dass die Strassen einige Stunden nach einem Erdrutsch wieder geöffnet sind oder dass sie im Winter nach heftigen Schneefällen unverzüglich geräumt werden. Solche Leistungen in Bezug auf den Unterhalt der Mobilität sind im Übrigen in vielen anderen Ländern nicht möglich. Abgesehen von diesen Überlegungen könnten für die Verbindung von gewissen Berggebieten auch Alternativen zur Strasse, zum Beispiel Seilbahnen, in Betracht gezogen werden.
Naturkatastrophen: Auch die Unternehmen bezahlen eine gesalzene Rechnung
Überschwemmte Keller, zerstörte Vitrinen oder Informatikserver unter Wasser: Auch die Walliser Wirtschaftsakteure wurden von den gewaltigen Unwettern im Kanton voll getroffen.
Beschädigte Infrastrukturen zwangen Arbeitgeber, eine komplexe und teure Logistik umzusetzen, um ihre Tätigkeit aufrechtzuerhalten. Sie mussten ihre Angestellten während der Aufräum- und Sanierungsarbeiten anderweitig unterbringen.
Der Schweizerische Versicherungsverband schätzte die versicherten Schäden an Gütern und Infrastrukturen im Wallis und im Tessin provisorisch auf rund 200 Millionen Franken. Zu diesem Betrag kommen natürlich noch die Verluste in Zusammenhang mit der vorübergehenden Schliessung von Betrieben an gewissen Standorten hinzu, die schwer zu beziffern sind.
In den grossen Industriebetrieben Constellium und Novelis, die direkt von der Überschwemmung durch die Rhone betroffen waren, konnten zwei Wochen nach dem Unwetter rund 1200 Angestellte immer noch nicht arbeiten.

